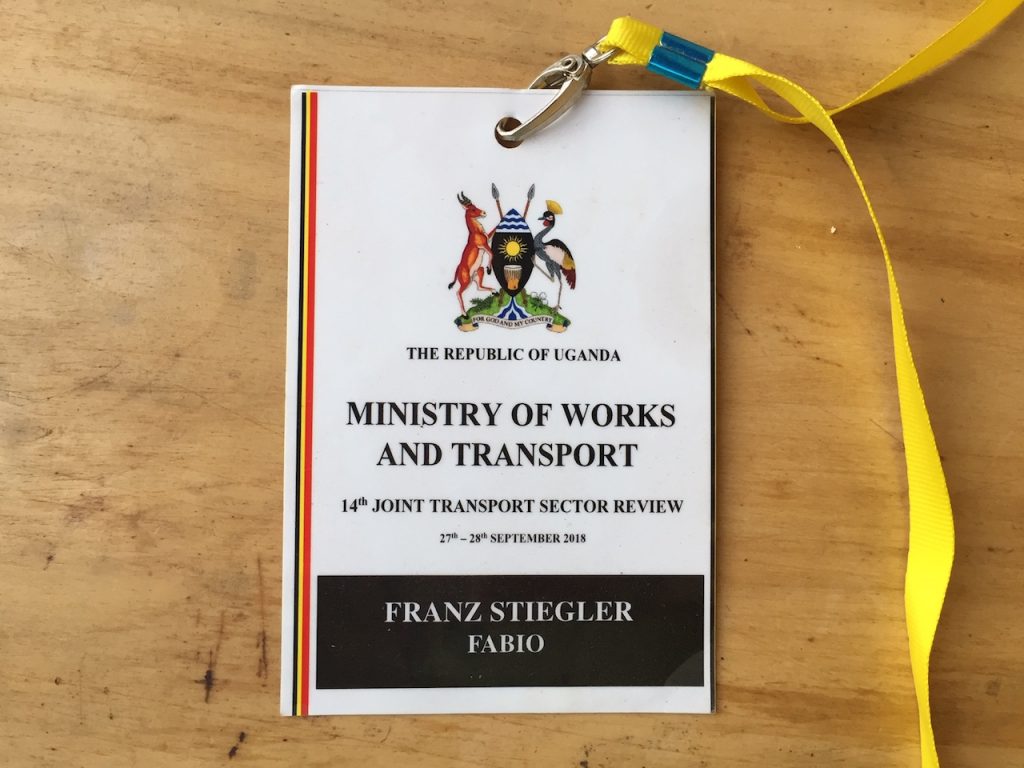Seit ca. 3 Monaten lebe ich jetzt in Malawi. Ich lebe in Malawi, häufig bin ich gefühlsmäßig von einem malawischen Leben jedoch weit entfernt. „Wie komme ich der malawischen Kultur möglichst nahe, wie verfolge ich mein Ziel des Herausfindens und Lernens?“, diese Frage warf ich zum Ende meines letzten Blogbeitrags auf (der zugegebenermaßen bereits ein Weilchen her ist) und sie hat sich seither zu meinem stetigen Begleiter gemausert. Jetzt schaue ich zurück auf meine bisherigen Erfahrungen: wo sind die Berührungspunkte mit der Kultur, wo bin ich ganz weit weg, was sind die Gründe, was wären mögliche Stellschrauben, warum nehme ich was wie wahr?

Beginnen wir mit dem Wohnen, das ja überhaupt erst Auslöser für das Aufwerfen der Frage zur kulturellen Begegnung war.
„Princess Prison“ und die Suche nach Zuhause
Während ich in Deutschland die Information, dass ich bei einer schottischen Familie wohnen würde, noch ganz gut aufnahm in der Annahme, dann gäbe es wenigstens keine Verständigungsprobleme, so merkte ich nach Ankunft recht schnell, dass es vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei sein könnte, wenn man eigentlich hergekommen ist, um malawisches Leben kennenzulernen. Der Lebensstandard, der mich hier umgibt, ist ganz und gar westlich geprägt. Das Viertel BCA Hill ist eines der reichen Leute. Hier ist jedes Grundstück von einem hohen Zaun mit bewachtem Tor umgeben. Grundstück umschließt in meinem Fall einen parkähnlichen Garten, das einstöckige Haus der Familie mit großer Küche, die ich mit nutze, die Staff Quarters (Zimmer für die Angestellten) und meine Einraumwohnung inklusive Bad. Das einzige, wo sich Malawi wirklich penetrant zu Wort meldet, sind die täglichen, fünfstündigen Stromausfälle, bei denen ich dann kein Warmwasser, sowieso kaum Wasserdruck und kein Licht habe (die Familie lässt sich auch davon nicht beeindrucken. Wofür gibt es schließlich Generatoren, die man sich in den Garten stellen kann?).
Begegnung mit der Kultur habe ich abgesehen davon mit den Angestellten. Wir grüßen uns immer lieb auf Chichewa und mit dem Koch führe ich morgens oder abends auch ganz schöne Gespräche in der Küche (wenn wir nicht gerade darum kämpfen, wer abspülen darf). Aus diesem Austausch lässt sich schließen, dass ich nicht die einzige bin, die sich hier nicht so 100%-ig wohlfühlt. Die ungute Stimmung, die manchmal wie ein Schleier über dem Haus zu hängen scheint, ist eins der weiteren Dinge, an denen ich neben der Einsamkeit, die in meinem Zimmer herrscht, zu knabbern habe. Ich verbringe hierin ungern mehr Zeit als nötig, aber da es in diesem Viertel nicht empfohlen wird, nach Einbruch der Dunkelheit allein unterwegs zu sein (besonders als weißes Mädchen) komme ich meistens direkt nach Arbeitsschluss um 5 nachhause. Obwohl ich hier so frei bin wie noch nie fühle ich mich manchmal eingesperrt, bzw. eher weggesperrt vor all den Erfahrungen, die ich in einem klassisch malawischen Umfeld machen würde. Daher auch die mehr oder weniger liebevolle Bezeichnung „Princess Prison“.
Zuhause. Ich weiß, was ich mir dafür in Malawi wünschen würde. Eine gemeinschaftliche Stimmung, die zu Austausch einlädt, Kinder, die vorbeikommen, einfach Malawier, mit denen ich mich unterhalten kann (also wäre es schon mal von Vorteil, wenn jemand Englisch spricht, sonst bleiben die Gespräche wohl auf einem relativ seichten Niveau). Eine Art Gastfamilie, bei der ich wirklich das malawische Leben kennenlernen kann oder aber eine Wohngemeinschaft mit jungen Malawiern, mit denen ich mich vielleicht auf ähnlicherem Level befinden und gut austauschen könnte. Ich war schon an einem Punkt, wo ich einfach unbedingt so sehr traditionelles, typisches Malawi wie möglich haben wollte. Ich lernte es kennen – für die Arbeit für zwei Nächte auf dem Dorf, Besuch bei einem Kollegen – und kam ins Stutzen. Möchte ich den Rest meines Aufenthalts ohne fließend Wasser leben, ohne Elektrizität, ohne ein weiches Bett, ohne mein morgendliches Porridge (wer mich kennt, weiß dass diese Frage einen tatsächlich beschäftigen kann :D)? Möchte ich nicht mehr selbst für mich einkaufen, selbst für mich kochen, selbst entscheiden, wann ich Hunger habe und wann nicht, wann ich nachhause komme und wann nicht? Ist es sicher für mich ohne Guard und wenn es abgelegen ist, wie pflege ich dann meine gerade keimenden sozialen Kontakte? Ich muss sagen, ich bin selbst gespannt, was ich für eine Lösung für mich finden werde. Es juckt mich immer noch in den Fingern, das Westliche hinter mir zulassen, auch mal ein bisschen Verzicht zu leben. Aber andererseits muss es sich irgendwie mit meinem „8 to 5“-Bürojob in BCA Hill vertragen. Und damit wäre auch schon die Überleitung zum nächsten Feld geschaffen, das sich theoretisch anbietet, um kulturelle Erfahrungen zu sammeln: die Arbeit.
Das abenteuerlustige Naturmädchen mit viereckigen Augen
Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als die Einsatzstellen verteilt wurden, als ich zum ersten Mal den Namen Renew’N’Able Malawi hörte. Die Information, ich solle vor allem journalistisch tätig sein mit dem Schreiben von Artikeln und Social Media Arbeit, das Wissen um eine deutsche Gründerin, Martina, der gepflegte Internetauftritt, die sympathisch wirkenden Teambilder, die Lage in Blantyre, dem kulturellen Zentrums Malawis – all das nahm mir so einiges an Sorgen, all das versprach ein vertrautes Umfeld.
„Renew’N’Able Malawi“ – ich stieß das Tor zögerlich zum ersten Mal auf und lernte die Menschen hinter den Teambildern kennen. Zwar keinesfalls qualitativ, wohl aber quantitativ weniger. Aufgrund von Funding Schwierigkeiten sind von einem ehemals rund 15-köpfigen Team noch 5 übrig, mich eingeschlossen. Dafür, dass RENAMA auf relativ vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, sind das sehr, sehr begrenzte Kapazitäten (was genau RENAMA alles macht, bzw. machen soll habe ich mittlerweile auch grob durchschaut und stelle es euch in einem eigenen Artikel vor – ich möchte ja den Rahmen hier nicht sprengen). Arbeit war also sofort genug für mich da. Bisher habe ich viel über Energiearmut in Malawi, Gründe und resultierende Probleme und das Potential erneuerbarer Energien recherchiert und diese Informationen dann schön für die Bildungswebsite Mphamvu-now zusammengetragen. Ich half auch bei ihrem Umbau im Design mit. Mit einem Kollegen zusammen durchforste ich täglich zwei Tageszeitungen nach energie-/umweltrelevanten Artikeln und stelle diese auf die Plattform Conrema, die ebenfalls gerade einem Facelift unterzogen wird. Daneben verfasste ich für eine Kooperation mit ecoLODGy (Samuels Einsatzstelle, Martinas neues Projekte, Aufbau einer ökologischen Lodge/Permakulturgarten/vegetarisches Restaurant) Handouts über bestimmte Praktiken der Agroforstwirtschaft und Permakultur und Berichte über durchgeführte Aktionen. In Zukunft soll noch verstärkt das Kümmern um Social-Media-Kanäle und um Crowdfunding hinzukommen.
All diese Arbeit findet vor einem Bildschirm in einem Bürozimmer statt, manchmal mit zwei Kollegen, die dasselbe Schicksal teilen, nicht selten aber auch ganz alleine. Jeder hat mal andere Dinge zu tun. Immer mal wieder fährt jemand zu Meetings und Präsentationen weg und ich habe neulich schwer darum gebeten, da doch auch mal mitzukönnen. Die Büroarbeit ist für mich wirklich ein zweischneidiges Schwert. Ich benutze generell gut und gerne meinen Kopf. Ich fand Spaß an der Seminararbeit in der 11. Klasse und genauso fühle ich mich jetzt manchmal – fokussiert, produktiv, mit flitzenden Fingern und ebenso flitzenden Gedanken. Wobei ich sagen muss, dass mir das gängige Konzept „du bleibst hier von 8 bis 5, egal, ob du Bäume ausreißt oder Blümchen gießt“ generell einleuchtet, ich es aber nicht wirklich als förderlich für die Motivation empfinde. Ich eigne mir hier sehr viel Wissen an – zu erneuerbaren Energien, traditionellen Kochweisen, Abholzung, Klimawandel, der PR-Arbeit einer NGO, Herstellung einer Harmonie mit der Natur, alles Themen, die mich wirklich interessieren. Ich komme mit meinen Kollegen gut klar, auch wenn wir für meinen Geschmack mehr Ideen austauschen könnten und mehr Lachen. Aber manchmal wird es mir einfach zu viel. Zu viel Laptop, zu viel Stille, zu viel abstraktes Denken, zu viel Sitzen, zu viel Ernsthaftigkeit – da wünsche ich mich raus in die Natur, möchte rennen und die Sonne spüren. Denn es ist mir auch zu wenig – zu wenig Begegnung mit dem malawischen Leben, zu wenig interessante Erfahrungen im Sinne von am eigenen Körper erfahren, zu wenig Durchgeschütteltwerden auf holpriger Straße. Ich lerne hier wirklich viel, aber das Lernen durch Lesen könnte noch mehr mit Lernen durch Erleben ergänzt werden.
Im Gespräch mit meinem Chef habe ich versucht, etwas in Bewegung zu bringen – in erster Linie mich selbst. Er schien meinen Wunsch zu verstehen und ich hoffe, in Zukunft, mehr in fortbestehende Feldprojekte à la Energiekioske und auch professionelle Meetings eingebunden zu werden. Vielleicht kann ich ja auch noch neue Möglichkeiten erschließen, bzw. alte wiederbeleben.
„Biete: offenes Mädchen, das lieb sein kann – Suche: kulturellen Austausch“
Aufgrund meiner gefühlten Abschottung habe ich bisher alle Möglichkeiten, doch mal richtig in unbekannte Gewässer einzutauchen mit offenen Armen empfangen.
Für die Zusammenarbeit mit ecoLODGy, in deren Rahmen Farmern der Schritt von konventioneller Landwirtschaft zu Permakultur ermöglicht wird, schreibe ich nicht nur, sondern mache auch aktiv bei den Workshops und Farmbesuchen mit. Es verwundert mich selbst manchmal, wie glücklich es mich macht, mit dem traditionellen Chitenje um die Hüften gebunden, Schweiß und Dreck auf der Stirn auf einem Feld irgendwo im nirgendwo zu stehen und dabei nur ein paar Wortfetzen von den Gesprächen um mich herum zu verstehen.
Ich lasse mir generell ungern eine Chance entgehen, auf die ecoLODGy Site zu fahren. Die Arbeiter dort sind einfach zu nett und inmitten all der Pflanzen kann man ja nur aufblühen.
Als wir für die Erstellung eines Energie-Glossar aufs Dorf fuhren (der erste Ausflug, bei dem ich mitdurfte), blieb ich dort für einen Tag länger. Ich lebte dort beim Chef des Dorfes und schlug mich allein auf Chichewa durch. Mit dem Motorradtaxi durch die weite Ebene brausen, das erste Mal Nsima kochen, Wasser auf dem Kopf durch die Gegend tragen, das Lehmhaus kehren, mit Kindern Figuren in den Sand malen, alles Erfahrungen, für die ich nicht dankbarer sein könnte.
Ich fahre gerne mit dem Minibus zum Markt und spaziere dort umher. Es bereitet mir eine Heidenfreude, auf englische Zurufe mit einer Erwiderung auf Chichewa zu reagieren. Generell empfinde ich die Sprache als Tor zu den Menschen. Viel zu spärlich sind meine Kenntnisse noch für meinen Geschmack, aber step by step arbeite ich daran.
Diesen Sonntag habe ich es auch endlich mal geschafft in die Kirche zu gehen und durfte dort ein bisschen singend durch die Gegend flitzen.
Und gilt es eigentlich als kulturelle Erfahrung, wenn man bei malawischen Freunden zuhause auf die krasseste Villa trifft, die man je gesehen hat? Ein weiterer Denkanstoß.
Danke, dass ihr an dieser Reise durch meinen Kopf teilgenommen habt ?. Wie immer freue ich mich über Feedback, Fragen und Gedanken!
Johanna
PS.: Mein Bruder hat mir beigebracht: „Traditionen wollen gepflegt werden“ und diesmal passt es einfach zu schön. Auf seinem Weg in den Wald hat sich das Rehkitz plötzlich die Hufe gestoßen. Ein Zaun versperrt den Weg. Mit ein paar anderen seiner Art wird es auf einer Lichtung festgehalten. Es kann das dichte Gestrüpp sehen, direkt vor seiner Nase ist der lebendige Wald. Gespannt beobachtet es, was da alles vor sich geht und schon bald juckt es in seinen Hufen, kopfüber in das Dickicht zu hüpfen, selbst ein Teil davon zu werden. Es könnte warten bis der Zaun rostet, aber um ehrlich zu sein, Geduld war noch nie seine Stärke. Wie gut, dass Rehe springen können…